Christina Morina ist mir schon länger als kluge und pointierte Historikerin ein Begriff. Mit Tausend Aufbrüche: Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er-Jahren hat sie nun ein Werk vorgelegt, das es bis zum Deutschen Sachbuchpreis 2024 geschafft hat – und das vollkommen zu Recht. Vielen Dank an den Siedler Verlag für das Rezensionsexemplar!
Das Buch unternimmt etwas, das in der deutschen Geschichtsschreibung lange gefehlt hat: Es erzählt eine integrierte Demokratiegeschichte von Ost und West, und zwar nicht aus der Sicht von Eliten oder großen politischen Akteuren, sondern aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger. Morina öffnet Archivkisten, sichtet Briefe, Flugblätter und Eingaben an „Partei und Regierung“ und macht damit Stimmen hörbar, die sonst selten im Rampenlicht stehen.
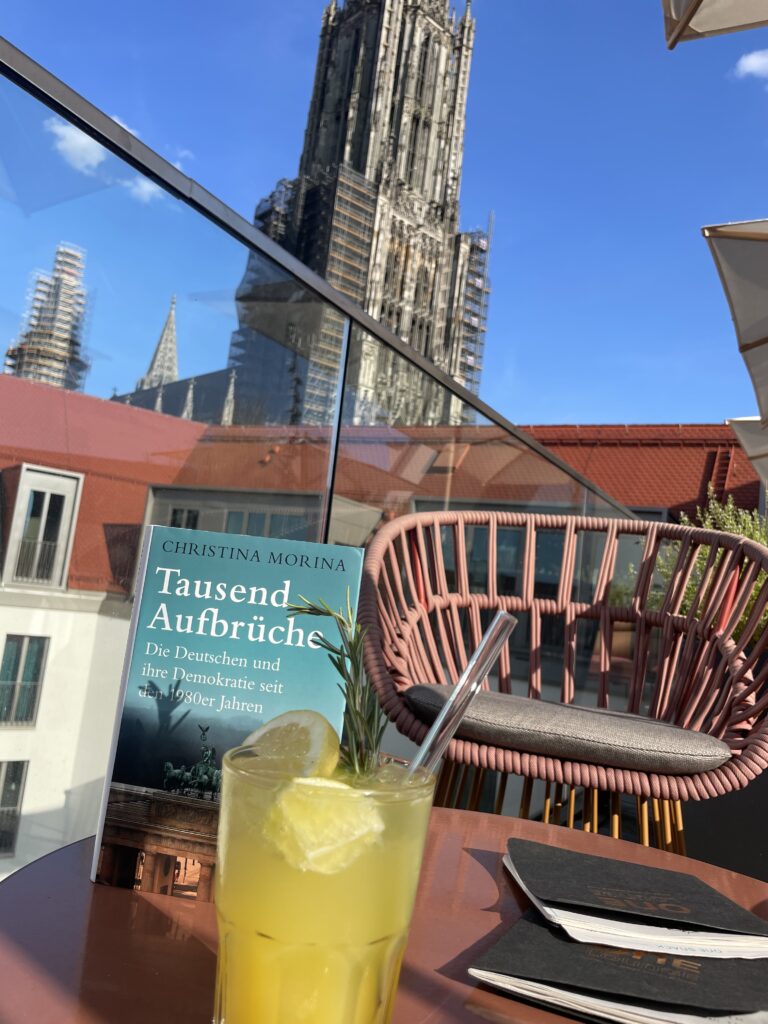
Besonders spannend fand ich ihre Kapitelstruktur: von den Fragen, was es heißt, Staatsbürger zu sein, über die „zwei Republiken“ der 1980er, bis hin zu den Ambivalenzen der Demokratie in der Merkel-Ära. Gerade die Brücke zwischen der DDR-Bürgergesellschaft und der gesamtdeutschen Demokratie nach 1989 ist etwas, das ich in dieser Form bisher kaum so detailliert gelesen habe. Als Westkind der 90er, das erst spät bewusst wahrgenommen hat, wie unterschiedlich Demokratie in Ost und West erlebt wurde, war die Lektüre für mich ein Augenöffner.
Natürlich bleibt das Buch nicht ohne Kritikpunkte. Manche Passagen wirken etwas akademisch und wiederholend, und nicht jede Darstellung der DDR-Gesellschaft geht so tief, wie es möglich gewesen wäre. Gerade Leser aus dem Osten merken sofort, wenn Aspekte verkürzt erscheinen oder „unter der Decke“ gelebte Freiräume nur am Rand vorkommen. Doch Morina gleicht das aus durch ihre akribische Quellenarbeit und den klaren Willen, nicht zu polarisieren. Sie beschreibt, wie Demokratie eben kein Zustand ist, sondern ein Prozess, an dem täglich gearbeitet und gestritten wird – und das ohne ideologische Grabenkämpfe.
Für mich persönlich war das Buch ein wichtiger Denkanstoß. Besonders die Briefe von „gewöhnlichen“ Menschen haben mich bewegt, weil sie zeigen, wie konkret Demokratie im Alltag erfahrbar wird: in Sorgen, Erwartungen und Forderungen, die damals an Politiker herangetragen wurden. Auch der Blick auf die Entwicklung der AfD oder die Rückschau auf Angela Merkels Kanzlerschaft bringt aktuelle Bezüge hinein, die das Werk sehr zeitgemäß machen.
Fazit: Tausend Aufbrüche ist ein kluges und anregendes Buch über die Demokratie in Deutschland – aus der Perspektive der Menschen, nicht der Mächtigen. Es zeigt, wie eng verflochten die Geschichten von Ost und West waren und sind, und warum wir Demokratie nie als abgeschlossen betrachten dürfen. Wer sich für die politische Kultur der Bundesrepublik interessiert – egal ob mit DDR-Erfahrung oder westdeutscher Sozialisation – sollte dieses Buch unbedingt lesen.
Hinweis: Das Buch wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür.

Schreibe einen Kommentar